 Eine
Dummy Load basteln
Eine
Dummy Load basteln© DC9ZP 2006
Einen
Abschlusswiderstand
für 100 Watt
selbst erstellen
Die
Amateurfunkverordnung[1] schreibt für Abgleicharbeiten und Messungen an Sendern
einen strahlungsfreien Abschlusswiderstand vor. Da diese Vorschrift auch in den
Vorgängerverordnungen enthalten war, müsste eigentlich jede Amateurfunkstelle
schon damit ausgerüstet sein, es sei denn man verzichtet(e) dauerhaft auf
eben diese Abgleicharbeiten und Messungen; ein Fall der in der Praxis
wohl selbst bei „Steckdosen-Funkamateuren“ schwer vorstellbar ist.
Ein
Abschlusswiderstand ausreichender Leistung, ist ein typisches Bastelobjekt für
Zeiten mit schlechten KW-Bedingungen, kann mit wenigen Mitteln auch an einem
verregneten Nachmittag erstellt werden und funktioniert im Gegensatz zu manch
aktiver Elektronik sofort und immer und bringt unzweifelhaften Nutzen.
Strahlungfreiheit,
ein unsicherer Rechtsbegriff
Gefordert
ist in [1] die Strahlungsfreiheit für
den Abschlusswiderstand, definiert in einer physikalischen und damit
nachvollziehbaren Größe ist der Begriff jedoch nicht. Das lässt dem
Funkamateur viel Raum für Interpretationen. Immerhin, auch ein perfekter
Abschlusswiderstand strahlt, wenn auch erheblich reduziert. Ziel muss es
also sein, die Konstruktion auch auf maximale „Strahlungsfreiheit“
anzulegen, sonst stört man ggf. unnötig im Nahfeld.
Pflichtenheft
·
Der Abschlusswiderstand
muss für den Sender eine möglichst reflektionsfreie, resistive Last von 50 Ohm
darstellen,
·
er muss die maximale
Ausgangsleistung des TX für eine definierte Zeit ohne Selbstzerstörung
aushalten und
·
unerwünschte
Aussendungen minimieren.
Hier soll eine Dummy Load hergestellt werden, die ohne Kühlung eine Leistung von 100 Watt mindestens für eine Minute
verkraftet
und unter 10 Euro kostet.
Praktische
Umsetzung
Der
erforderliche Widerstand von 50 Ohm wird durch das Parallelschalten von 54
Metalloxydwiderständen (Bild 1) der Reihe E12 mit 2.7 KOhm[2] und einer
Belastbarkeit von je 2 Watt erzielt. Das ergibt eine rechnerische Belastbarkeit
von ca. 100 Watt. Die Leistung darf aber ohne Zwangskühlung durch Lüfter etc.
nur für ca. eine Minute anliegen, sonst werden die Widerstände zu heiß. Durch
die Zusammenschaltung der Widerstände werden Induktivitäten minimiert, die
Last erscheint rein resistiv und das Stehwellenverhältnis im KW-Bereich geht
über 1:1.1 nicht hinaus, auf im
2-m Band ergeben sich 1:1,5.
Bild
1 zeigt den Größenvergleich des Widerstandes mit einem 2 Cent Stück, für
eine Belastung von 2 Watt sind die Maße - Länge 12 mm und Durchmesser 3.6 mm -
sehr klein geraten und lassen einen kompakten Aufbau zu.
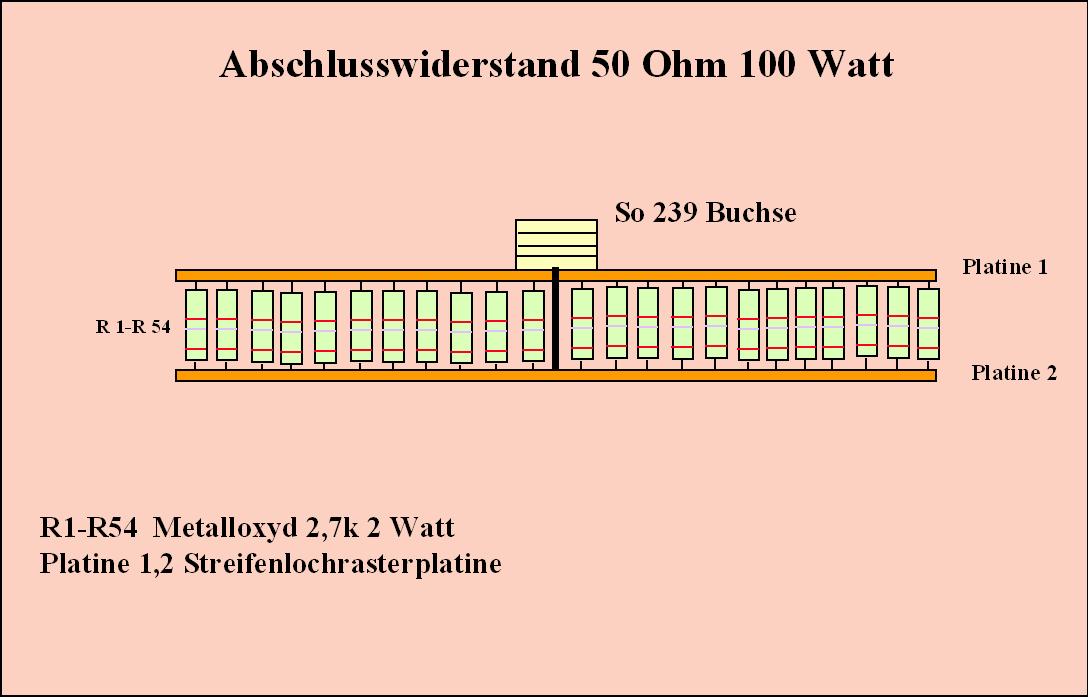
Prinzipschaltbild mit Bestückungsplan
Bei
meinem Musterexemplar ( Bild 2) ergab sich nach dem Zusammenlöten ein
Widerstand von 50,8 Ohm, der nach einiger Einbrennzeit auf 49,8
Ohm fiel. Da die Widerstände ( Bezugsquelle [2]) eine Toleranz von 5%
aufweisen, ergeben sich Streuungen, die durch späteres Hinzufügen oder
Auskneifen einzelner Exemplare aber leicht ausgleichbar sind. Die Anzahl der
Widerstände kann man für größere Belastungen erhöhen, für 200 Watt nimmt
man also ca. 104 Exemplare a 2 Watt mit einem
Widerstand von 5,2 KOhm.
Die
Widerstände werden durch zwei Lochraster Platinen (Streifenlochraster) gesteckt
und festgelötet. Der Abstand der beiden Platinen ergibt sich aus der Länge der
Widerstände (12 mm). Die Anschlussdrähte werden nach dem Einlöten
abgekniffen. Eine SO239 Buchse wird direkt auf die oberste Platine gelötet, der
Mittelstift wird mit einem möglichst dicken Draht mit der unteren Platine
verbunden. Da die einzelnen Streifen der Platinen untereinander keine Verbindung
haben, werden an jeweils mindestens 3 Stellen Brücken mit 1mm Draht schaffen
(Bild 2).
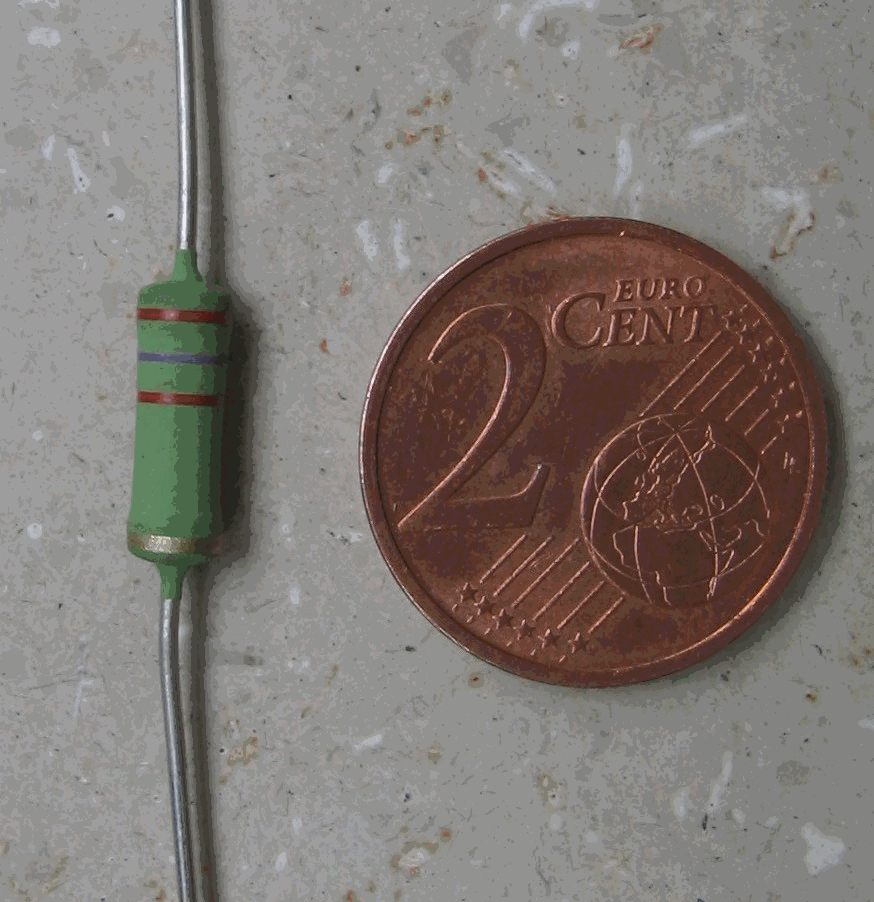
Bild 1: Größe des verwendeten Metalloxydwiderstandes 2
Watt
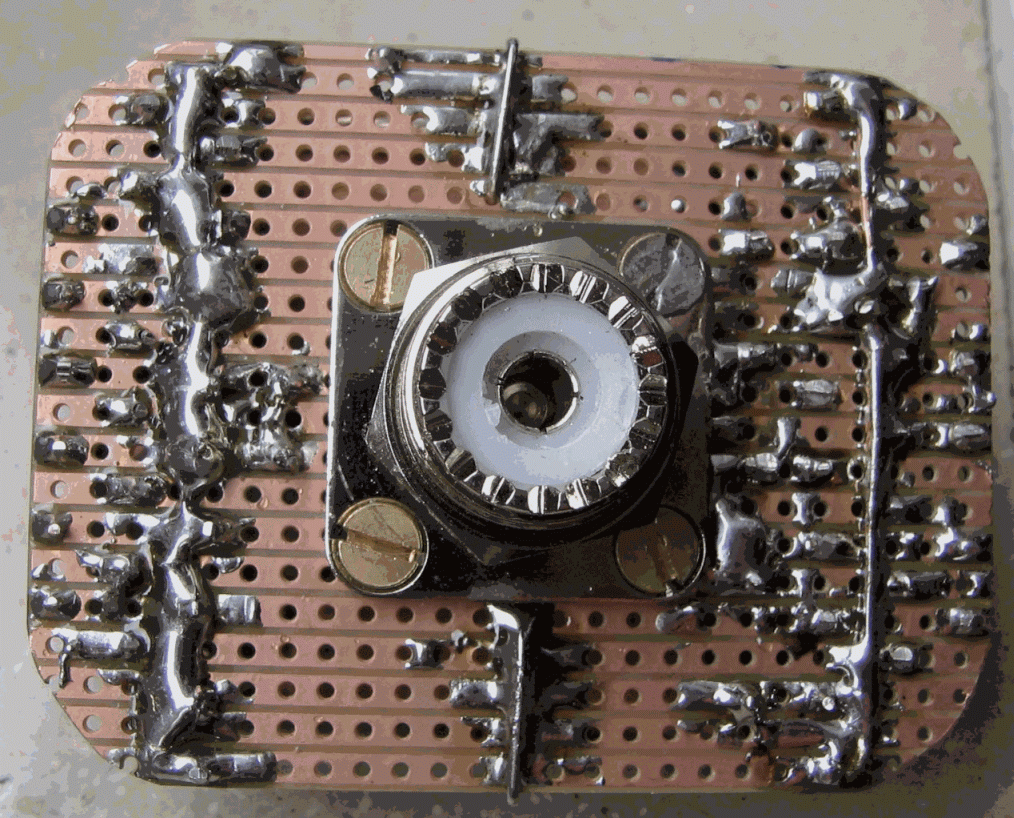
Bild 2: Laboraufbau des Abschlusswiderstandes, noch nicht
schön, aber sehr wirkungsvoll.
Der
Aufbau ist natürlich auch zwischen zwei voll verkupferten Leiterplatten oder
Blechen denkbar, dann muss man aber 108 Löcher selbst bohren und die
Herstellung wird zeitaufwändiger und fummelig.
Strahlungsreduzierung
Hat
man den Zusammenbau ohne Probleme geschafft, dann kann man sich Gedanken machen,
die Abstrahlung des Abschlusswiderstandes zu reduzieren. Dazu bietet sich der
Einbau in ein hf-dichtes Metallgehäuse an. Bei der Inspektion der Küche fiel
mir eine würfelförmige Teedose (Bild 4) auf, die mit einer Kantenlänge von 9
cm und einer runden Öffnung von 8 cm, die richtigen Maße hatte.
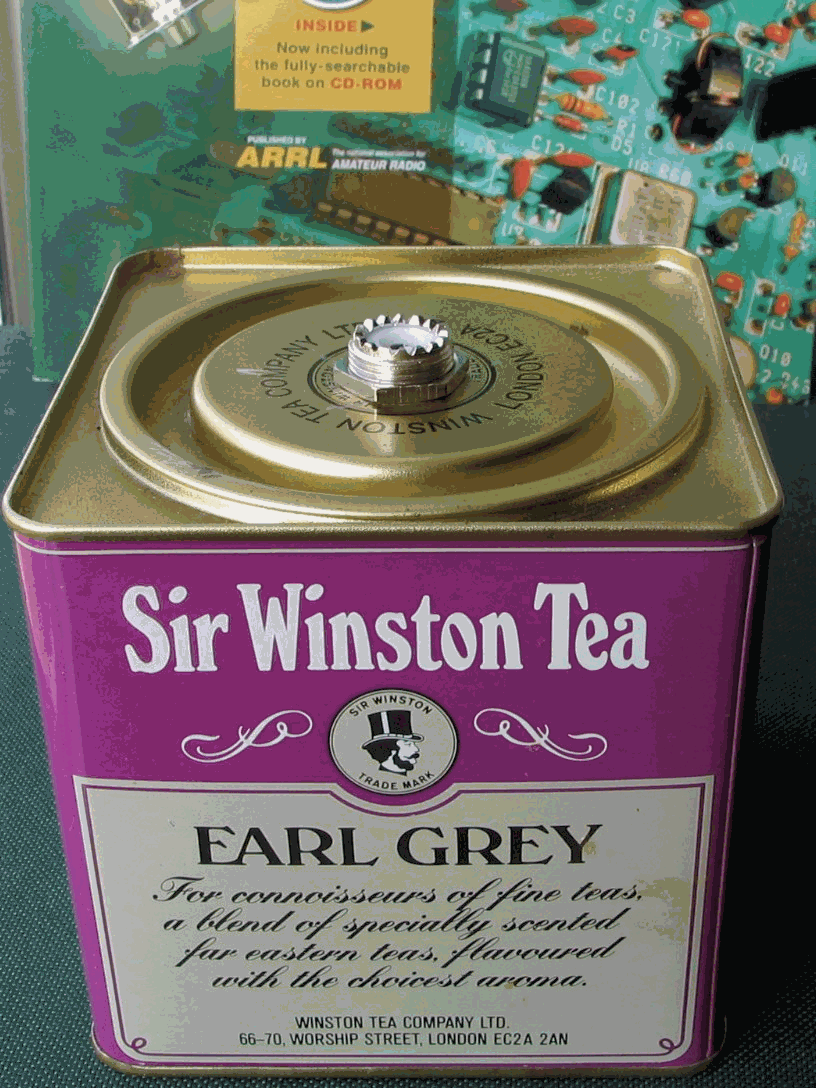
Bild
3: Abschlusswiderstand und der graue Graf vertragen sich gut.
Der
Einbau brachte eine Reduzierung der Abstrahlung um 25 dB, gemessen mit einem
Zweitempfänger in ca 10 m Entfernung, und hat sich damit gelohnt. Eine weitere
Absenkung der Strahlung um ca. 10 dB ergab sich durch Weglassen des
Koaxialkabels zwischen TX und Dummy Load und ersatzweises Einschalten einer
Mantelwellensperre aus Ferroxcube Ferritkernen, wie sie bei [3] entweder fertig
konfektioniert angeboten werden, oder durch
von dort gelieferte Ringkerne leicht selbst hergestellt werden kann ( Bild 5).
Zwanzig Ringkerne vom Typ Ferroxcube CST9.5/5.1/15-3S4 werden auf ein ca 40 cm
langes Koaxialkabelstück RG58U geschoben, das Kabel wird mit Steckern/Buchsen
versehen, fertig. Die Mantelwellensperren oder auch 1:1 BALUN genannt, machen
sich auch bei der Anpassung von endgespeisten Antennen verdient und wurden
zuerst von W2DU in[4] beschrieben.
Leistungserhöhung
Um
die Leistung und damit die Stehzeit zu erhöhen, kann man den
Abschlusswiderstand durch einen Lüfter kühlen. Dazu bietet sich u.a. der
Einbau in das Gehäuse eines bis auf den Lüfter ausgeschlachteten
ATX-Netzteils an.
Literatur/Fundstellen
[1]
Verordnung zum Gesetz über den Amateurfunk, (Amateurfunkverordnung – AFuV)
vom
15. Februar 2005, § 16 Abs. 6
[2]
Bezugsquelle: Fa. Reichelt, Sande, Metalloxydwiderstand,
Bestellnummer
:„2WMetall 2,7K“, Preis a 9 Cent. (http://www.reichelt.de)
[3]
Firma JATAM GbR. 96106 Ebern, Pilsener Weg 10, http://www.jatam.de
[4]
ARRL Handbook, Newington CT, Fundort in der aktuellen Ausgabe 2005 : Chapter 21,
Seite 21.16
Bearbeitungstand dieser Seite : 19.04.06